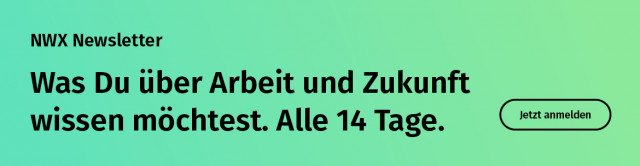"Das Büro wird vom Arbeits- zum Begegnungsort"
Interview mit Milena Bockstahler / Fraunhofer IAO
Wo liegt die Zukunft unserer Arbeit? Im Homeoffice oder Büro? Die Diskussion greift zu kurz, sagt Milena Bockstahler*. Im Interview erklärt die Wissenschaftlerin des Fraunhofer IAO, warum hybride Arbeitsplatzmodelle neue Denkweisen erfordern – und wie Unternehmen Räume, Regeln und Rollen neu gestalten sollten, um zukunftsfähig zu bleiben.
NWX Magazin: Frau Bockstahler, die Diskussion um Homeoffice vs. Büro reißt nicht ab. Warum gibt es bei diesem Thema noch so viel, teils aufgeregte, Bewegung und Unsicherheiten?
Milena Bockstahler: Weil es letztlich nicht um den Ort, sondern um grundlegende Fragen der Arbeitskultur geht: Vertrauen, Kontrolle, Selbstorganisation, Zugehörigkeit und Identifikation mit dem Unternehmen. Homeoffice und hybride Modelle bringen neue Anforderungen mit sich – sowohl an Führung als auch an Zusammenarbeit. Unsere Studien** zeigen, dass sich ein Drittel der Beschäftigten im Homeoffice produktiver fühlen als im Büro. Gleichzeitig berichten rund 60 Prozent, dass der soziale und informelle Austausch im Homeoffice zu kurz kommt und sie deswegen ins Büro gehen. Unternehmen suchen noch nach einem neuen Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Verbindung – und das braucht Zeit, Reflexion und Dialog.
Welche Rolle spielen Büroflächen künftig überhaupt noch – insbesondere im Hinblick auf interne Zusammenarbeit und Unternehmenskultur?
Bockstahler: Das Büro wandelt sich vermehrt vom Arbeits- zum Begegnungsort. Rund die Hälfte der Befragten sehen das Büro künftig vor allem als Raum für Austausch und Meetings – konzentrierte Aufgaben werden oftmals lieber im Homeoffice erledigt. Für viele wird das Büro nicht mehr der tägliche Arbeitsplatz sein, sondern ein Ort für gezielte Zusammenarbeit, kreative Prozesse oder Teambuilding. Räume müssen nach wie vor beides unterstützen, also sowohl den Austausch als auch das konzentrierte Arbeiten – durch modulare, offene und zugleich rückzugsfähige Konzepte. Physische Präsenz wird nach wie vor ein starkes Signal für Zugehörigkeit und Identifikation sein. Die Herausforderung liegt darin, Räume so zu gestalten, dass sie Mehrwert bieten und sich vom Arbeitsplatz im Homeoffice abheben.
Welche Empfehlungen geben Sie Unternehmen ganz konkret, die sich gerade mit der Gestaltung ihrer zukünftigen Arbeitsplätze auseinandersetzen?
Bockstahler: Erstens: Mitarbeitende einbeziehen – sie kennen ihre Bedarfe und Arbeitsweisen am besten. Zweitens: Flexibilität ernst nehmen – nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch. Drittens: Räume nicht nur funktional denken, sondern auch als kulturelle Angebote. Es hilft, in Zonen statt in klassischen Raumtypen zu planen – z. B. für Fokusarbeit, Austausch oder Erholung. Und schließlich: Pilotieren, evaluieren, weiterentwickeln. Auffällig ist, dass nur 28 % der Befragten angeben, dass es in ihrem Unternehmen bereits klare Regeln für hybride Zusammenarbeit gibt – hier besteht noch viel Potenzial.
Gibt es denn überzeugende Argumente für Präsenzzeiten im Büro, die auch Skeptiker von hybriden Modellen anerkennen könnten?
Bockstahler: Ein zentrales Argument ist der deutlich bessere Informationsfluss im Büro. 61 % der Befragten berichten, dass sie dort leichter Zugang zu informellen Informationen und organisationalem Wissen haben. Gerade dieser nicht-offizielle, oft beiläufige Austausch – etwa im Flur, in der Kaffeeküche oder zwischen zwei Meetings – ist schwer zu ersetzen, aber entscheidend für gute Abstimmung und schnelle Entscheidungen. Wer selten im Büro ist, bekommt seltener mit, was "zwischen den Zeilen" passiert – und riskiert, den Anschluss an informelle Wissensströme zu verlieren. Präsenzzeiten bieten daher eine wichtige Chance, Transparenz und Einbindung zu stärken – vor allem in komplexen oder dynamischen Arbeitsumfeldern.
Wie lassen sich hybride Arbeitsmodelle so gestalten, dass sie auch langfristig gesund, produktiv und nachhaltig sind?
Bockstahler: Indem man drei Ebenen zusammendenkt: Individuum, Team und Organisation. Auf individueller Ebene braucht es Autonomie, aber auch Struktur – z. B. durch klare Arbeitszeiten, Pausen und Grenzen. Teams müssen Kommunikationsregeln, Erreichbarkeiten und gemeinsame Präsenzzeiten definieren. Auf organisationaler Ebene spielen Vertrauen, Führung und ein lernförderliches Umfeld eine zentrale Rolle. Unsere Daten zeigen: Über 70 % der Befragten, die über Arbeitszeit und -ort mitentscheiden können, berichten von besserer Work-Life-Balance und geringerer Belastung.
Welche organisatorischen und technologischen Voraussetzungen braucht ein funktionierender hybrider Arbeitsplatz heute?
Bockstahler: Technisch: Eine stabile, sichere Infrastruktur für kollaboratives Arbeiten – inklusive mobiler Endgeräte, cloudbasierter Tools und Datenschutzkonzepte. Organisatorisch: klare Rollen, transparente Prozesse und die Bereitschaft, Führungsverständnisse weiterzuentwickeln. Hybrides Arbeiten funktioniert nicht durch Tools allein – sondern durch Vertrauen, Selbstverantwortung und eine Kultur, in der Ergebnisse wichtiger sind als Präsenz.
Wie können Unternehmen, auch kleinere und mittlere, ihren Mitarbeitenden eine moderne Arbeitsumgebung bieten, ohne komplette Bürokonzepte à la Großkonzerne einzuführen?
Bockstahler: Viele KMU haben einen Vorteil: kürzere Entscheidungswege und Nähe zu ihren Mitarbeitenden. Es braucht nicht immer High-End-Design – oft reichen pragmatische Lösungen, die echte Bedürfnisse aufgreifen. Beispiele sind mobile Arbeitsplätze, flexible Zeitmodelle oder kleinere Satellitenstandorte. Auch Kooperationen – etwa bei Coworking-Spaces – können sinnvoll sein. Wichtig ist, die eigene Arbeitskultur als Ausgangspunkt zu nehmen und sich nicht an Idealbildern großer Konzerne zu orientieren, die vielleicht gar nicht zur eigenen Realität passen.
Die Diskussion um Homeoffice betrifft vor allem Wissensarbeiter*innen. Wie sollten Unternehmen die Arbeitswelt für Mitarbeitende gestalten, deren Tätigkeiten sich nicht ins Homeoffice verlagern lassen?
Bockstahler: Indem man das Prinzip der Flexibilität auch jenseits des Arbeitsorts denkt. Arbeitszeitmodelle, Mitgestaltungsmöglichkeiten, Erholungszeiten und Entwicklungsperspektiven sind wichtige Stellschrauben. Auch diese Beschäftigtengruppen wünschen sich mehr Autonomie und Wertschätzung – nicht nur bessere Technik. Unternehmen können viel gewinnen, wenn sie nicht nur in Homeoffice-Konzepte investieren, sondern parallel überlegen, wie sie auch anderen Berufsgruppen echte Gestaltungsspielräume bieten.
Welche bereits erfolgreichen Ansätze sehen Sie, um auch für diese Berufsgruppen mehr Flexibilität, Autonomie oder Chancen auf neue Arbeitsformen zu schaffen?
Bockstahler: Einige Unternehmen arbeiten z. B. mit selbstorganisierten Schichtplänen oder ermöglichen Micro-Learning-Formate in Randzeiten. Andere führen „stille Stunden“ ein – Zeiträume ohne Störungen oder Kund*innenkontakt. Auch Job-Rotation, temporäre Projektarbeit oder die Nutzung von Pausenräumen als Lernorte sind Ansätze, die zeigen: Selbst wenn der Arbeitsort fix ist, kann man an vielen Stellschrauben drehen, um Teilhabe und Entwicklung zu fördern. Es geht darum, Flexibilität neu zu definieren – nicht nur als Ortsunabhängigkeit, sondern als Kultur des Mitgestaltens.
Interview: Ralf Klassen
*Zur Person: Milena Bockstahler ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team »Workspace Innovation« des Fraunhofer IAO tätig. Ihr Forschungs- und Beratungsschwerpunkt liegt im Bereich mobiles Arbeiten, worüber sie insbesondere im Zuge der Pandemie zahlreiche Artikel und Studien geschrieben hat. Außerdem untersucht sie den Einfluss des organisatorischen und räumlichen Umfelds auf die Kreativität von Büro- und Wissensarbeitenden und promoviert zu diesem Thema. Sie ist Teil der Innovationsnetzwerke OFFICE 21 und Future Meeting Space.
*Lektürehinweis: Die vom Fraunhofer IAO im Rahmen des Innovationsnetzwerks OFFICE21 durchgeführte Studie „Homeoffice Experience“, an der u. a. Milena Bockstahler beteiligt war, untersucht die Erfahrungen von über 2.000 Büro- und Wissensarbeitenden während der Corona-Pandemie. Das Ergebnis: Mitarbeitende wünschen sich mehr Flexibilität, gleichzeitig bleibt das Büro zentral für Austausch und Teamkultur. Die Studie empfiehlt klare hybride Modelle und eine bessere Ausstattung für das Homeoffice.