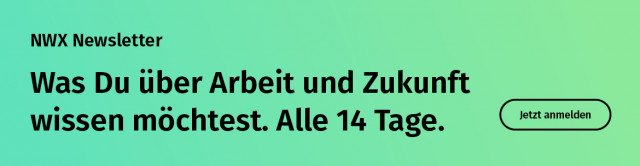So stärken Führungskräfte ihr Team - und sich selbst
Prof. Dr. Silja Hartmann über resiliente Teams, authentische Führung und empathische Vorgesetzte
Es ist einer der meist verwendeten Begriffe in der aktuellen Krise: Resilienz gilt auch im Job als mentale Superkraft – aber was genau steckt dahinter? Wie lässt sie sich stärken? Und was können Führungskräfte für die eigene Widerstandskraft tun? Silja Hartmann ist Professorin für Strategische Führung und Nachhaltigkeitsmanagement an der Technischen Universität Berlin und Expertin für Psychologische Resilienz. Im Interview mit NWX Magazin Autorin Kirstin von Elm erklärt sie, dass Resilienz mehr ist als ein dickes Fell und warum auch Vorgesetzte gerade in schwierigen Situationen Gefühle zeigen sollten.
NWX Magazin: Frau Professorin Hartmann: Resilienz gilt als Super Power für herausfordernde Zeiten. Was genau ist damit gemeint?
Silja Hartmann: Psychologische Resilienz beschreibt die positive Bewältigung von widrigen Ereignissen. Sie umfasst also zwei Aspekte: das Erleben einer negativen Situation, die beispielsweise das Wohlbefinden, die Motivation oder die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Und dann die erfolgreiche Bewältigung, die es uns ermöglicht, zu unserem ursprünglichen Leistungsniveau oder unserem ursprünglichen Wohlbefinden zurückzukehren – oder besser noch - gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Als Super Power würde ich psychologische Resilienz allerdings nicht bezeichnen, denn das könnte nahelegen, dass nur einige wenige Personen über psychologische Resilienz verfügen. Tatsächlich können wir unsere psychologische Resilienz aber trainieren und stärken.
Es geht also um mentale Widerstandskraft?
Silja Hartmann: Die deutsche Übersetzung von Resilienz als Widerstandskraft finde ich nicht ganz passend. Es geht nicht darum, negative Ereignisse ungerührt an sich abprallen zu lassen. Ganz im Gegenteil: Ein Rückschlag bei der Entwicklung eines neuen Produktes, der Abbruch eines wichtigen Projekts, eine Kündigungswelle oder eine gescheiterte Präsentation vor Investoren gehen nicht spurlos an uns vorbei, sondern verursachen Gefühle wie Enttäuschung, Wut, Angst, Trauer oder einfach ein Gefühl der Unsicherheit. Resilienz bedeutet, negative Emotionen und Unsicherheit zu akzeptieren und konstruktiv damit umzugehen, so dass sie mich nicht langfristig beeinträchtigen.
Kann man das lernen?
Silja Hartmann: Ja, in der aktuellen Forschung wird Resilienz weniger als vorgegebene Charaktereigenschaft verstanden, sondern eher als Potenzial zur Krisenbewältigung. Dieses Potenzial können wir stärken, indem wir bewusst entsprechende Ressourcen aufbauen. Zudem ist Resilienz nicht nur ein Potential oder ein Ergebnis, sondern auch ein Prozess. Es geht darum, vorhandene Ressourcen und Stärken aktiv zu nutzen, um erfolgreich mit widrigen Situationen umzugehen. Auch das lässt sich trainieren.
Haben Sie dafür ein konkretes Beispiel?
Silja Hartmann: Ja, ein stabiles und unterstützendes soziales Netzwerk ist zum Beispiel eine wichtige Ressource, die man aufbauen und pflegen kann. Wenn wir aber dieses Netzwerk in einer Krise nicht nutzen, bringt es uns nichts. Es ist also wichtig, diese Ressource zu aktivieren, also zum Beispiel sich mit Kolleg*Innen auszutauschen oder gezielt um Rat und Unterstützung zu bitten, um die Situation zu bewältigen. Das kann man üben und es stärkt die Resilienz.
Sind resiliente Mitarbeitende der Schlüssel zu einem krisenfesten Unternehmen?
Silja Hartmann: Nur bedingt. In der modernen Arbeitswelt spielt Teamarbeit eine zentrale Rolle. Studien zeigen: Mehrere resiliente Personen ergeben nicht automatisch ein resilientes Team, umgekehrt kann ein resilientes Team aus Mitarbeitenden bestehen, die sich selbst nicht als besonders resilient einstufen. Im Team ist Kollaboration gefragt. Wenn resiliente Teammitglieder in einer Krise ihre Ressourcen nur für die eigenen und nicht für gemeinsame Ziele aufwenden, ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht förderlich für die Teamleistung. Umgekehrt kann eine positive Teamkultur allen Teammitgliedern bei negativen Ereignissen Kraft geben.
Teamresilienz ist einer Ihrer Forschungsschwerpunkte. Was empfehlen Sie Unternehmen?
Silja Hartmann: Ein Aspekt, der sich in Studien als wichtiger Einflussfaktor herauskristallisiert hat, ist der Umgang mit Emotionen am Arbeitsplatz. Gefühle gelten im beruflichen Kontext eher als nebensächlich oder gar unprofessionell. Doch Emotionen – positive und negative - gehören zum Arbeitsleben dazu und sollten angemessen wahrgenommen werden. Unternehmen können die Teamresilienz fördern, indem sie eine Kultur etablieren, die Emotionen zulässt und positive Gefühle verstärkt.
Das müssen Sie bitte etwas näher erklären …
Silja Hartmann: Positive Emotionen stärken die psychologische Resilienz auf mehrfache Weise. Sie helfen uns bei der Erholung von belastenden Gefühlen wie Angst oder Trauer. Geteilte Freude führt außerdem dazu, dass Menschen sich einander näher fühlen. Freude stärkt also soziale Beziehungen und das Wirgefühl. Positive Emotionen machen uns offener für andere Ideen und Herangehensweisen und damit auch flexibler, wenn es um die Bewältigung von Krisen geht. Eine wichtige positive Emotion ist beispielsweise Freude. Es gibt aber auch leisere, positive Emotionen, wie Dankbarkeit oder Hoffnung, die die psychologische Resilienz stärken könne. Wichtig ist, diese Emotionen, aber auch das Zulassen und Teilen dieser Emotionen, langfristig in die Teamkultur zu etablieren.
Wie können Führungskräfte eine Kultur der Freude schaffen?
Silja Hartmann: Eine Kultur der positiven Emotionen lässt sich nicht einfach von heute auf morgen aufbauen.Führungskräfte sind dabei wichtige Rollenvorbilder. Durch viele kleine Schritte bewirken sie mehr als durch eine flammende Rede oder ein teures Teamevent. Es geht darum, positive Impulse im Arbeitsalltag zu verankern. Dabei können ihnen Routinen und Rituale helfen, zum Beispiel kleine Erfolge und Zwischenziele ganz bewusst zu würdigen und sich gemeinsam über das Erreichte zu freuen. Oder gemeinsame Interessen in angemessenem Rahmen auch am Arbeitsplatz zu thematisieren und zu pflegen.

Ob ein Team resilient ist, hängt also in erster Linie von der Führungskraft ab?
Silja Hartmann: Das würde ich so nicht sagen. Unsere Studien legen nahe, dass psychologische Resilienz kontextbezogen ist. Das heißt: Für die Bewältigung von beruflichen Krisensituationen haben soziale Beziehungen am Arbeitsplatz oft mehr Gewicht als Familie oder Freunde. Führungskräfte können also viel zur Teamresilienz beitragen, indem sie eine positive Kultur der gegenseitigen Unterstützung fördern, statt negative Gefühle wie Angst, Ohnmacht oder ungesunde Konkurrenz zu schüren. Allerdings können Teams ihre Resilienz auch von innen heraus stärken. Beispielsweise ist eine gelebte gegenseitige Fürsorge ein wichtiger Schlüssel für gesteigerte Teamresilienz. Das heißt: sich gegenseitig zuhören, füreinander da sein, sich gezielt unterstützen und einspringen, wenn jemand kurzfristig ausfällt, und gemeinsam Strukturen zu schaffen, um handlungsfähig zu bleiben. Dies sind wichtige Schritte, um Krisen gemeinsam als Team erfolgreich zu meistern.
Und wie können Führungskräfte in herausfordernden Zeiten die eigene Resilienz fördern?
Silja Hartmann: Im Prinzip profitieren sie von positiven Emotionen und einer positiven Teamkultur auf dieselbe Weise wie alle anderen Teammitglieder. Wichtig ist, in der Führungsrolle die eigene Identität zu wahren. Ein authentischer Führungsstil im Einklang mit den persönlichen Werten und Stärken fördert ebenfalls die Resilienz – sowohl die eigene als auch die des Teams.
Also nicht jede Krise krampfhaft schön reden?
Silja Hartmann: Das könnte sich sogar negativ auswirken. Zu authentischer Führung gehört authentische Kommunikation. Wer als Führungskraft selbst von einem Rückschlag hart getroffen ist, darf das auch sagen. Und Sie sollten langfristig denken. Im beruflichen Kontext sprechen wir häufig nur über die kurzfristige Leistung. Aber auch die mentale und physische Gesundheit sind wichtig. Nach einer Krise schnell zur alten Performance zurückzufedern, aber kurz darauf erschöpft zusammenzubrechen, ist für mich kein resilientes Ergebnis.
Interview: Kirstin von Elm
*Zur Person: Silja Hartmann leitet das Fachgebiet Strategische Führung und Nachhaltigkeitsmanagement an der Technischen Universität Berlin. In ihrer Forschung beleuchtet sie, wie Führung und Zusammenarbeit aus der Perspektive der Nachhaltigkeit gelingen können, gestützt auf verhaltenswissenschaftliche Theorien. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Zusammenarbeit in dynamischen und herausfordernden Arbeitsumfeldern. Silja Hartmann hat an der Ludwigs-Maximilian Universität 2019 zu Team-Resilienz promoviert. (LinkedIN-Profil)
Ausgewählte Fachartikel zum Thema:
How does an emotional culture of joy cultivate team resilience? A sociocognitive perspective (Silja Hartmann, Matthias Weiss, Martin Hoegl, Abraham Carmeli)
Yes, we (still) can! A qualitative study on the dynamic process of team resilience (Silja Hartmann, Matthias Weiss, Martin Hoegl)
Team resilience in organizations: A conceptual and theoretical discussion of a team-level concept (Silja Hartmann, Matthias Weiss, Martin Hoegl)