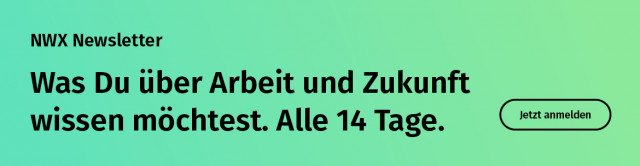Darum scheitern viele KI-Projekte in Unternehmen
Aktuelle Studie des MIT bremst Erwartungen
Weltweit investieren Unternehmen Milliarden in KI-Strategien und -Produkte – doch der erhoffte Durchbruch bleibt meist aus. Eine neue Studie des Massachusetts Institute of Technology zeigt: Nur ein Bruchteil der Projekte liefert messbare Resultate. Die Ursachen liegen weniger in der Technik als in der Organisation selbst.
Die aktuelle MIT-Studie „The GenAI Divide – State of AI in Business 2025“ analysiert über 300 KI-Initiativen in den USA und stützt sich auf Interviews mit mehr als amerikanischen 150 Führungskräften aus unterschiedlichen Branchen. Ihr Befund ist eindeutig: Rund 95 Prozent der Pilotprojekte mit Künstlicher Intelligenz erzeugen keinen erkennbaren geschäftlichen Mehrwert. Nur etwa fünf Prozent führen zu einer spürbaren Umsatzsteigerung oder Effizienzverbesserung.
Tiefgreifende Veränderungen durch die KI-Integration sind laut der MIT-Untersuchung bislang nur in wenigen Branchen erkennbar. Obwohl generative KI in nahezu allen Sektoren getestet wird, identifizieren die Forschenden nur in zwei von acht untersuchten Geschäftsfeldern klare strukturelle Verschiebungen. In vielen Bereichen führt der Einsatz von KI vor allem zu punktuellen Produktivitätsgewinnen, etwa durch Assistenzsysteme, die individuelle Arbeitsabläufe beschleunigen. Diese Effekte bleiben jedoch meist auf die Ebene einzelner Tätigkeiten begrenzt und entfalten nur selten spürbare Wirkung auf zentrale Geschäftskennzahlen.
Die Studien-Autoren konstatieren ein deutliches Bild der Diskrepanz zwischen Innovationsanspruch und praktischer Umsetzung: Während Unternehmen mit großem Aufwand experimentieren, bleiben viele Projekte in der Testphase stecken und schaffen es nicht, nachhaltige Effekte in der Wertschöpfung zu erzielen. Die Forschenden sprechen in diesem Zusammenhang von einer „KI Lücke“ – einer wachsenden Kluft zwischen technologischer Machbarkeit und organisatorischer Realität. Denn zentraler Engpass sei nach Einschätzung der MIT-Forschenden nicht die Qualität der Modelle, sondern die fehlende Integration in bestehende Strukturen. Entscheidender als Rechenleistung oder Datenvolumen sei die Fähigkeit von Organisationen, neue Systeme in ihre Arbeitsabläufe einzubetten und daraus zu lernen.
Hinzu kommt eine strategische Schieflage: Die meisten Investitionen fließen laut Bericht in sichtbare Front-Office-Bereiche wie Vertrieb oder Marketing, während das größere Potenzial häufig in der Automatisierung interner Prozesse liegt. Zudem zeigen externe Partnerschaften bessere Ergebnisse als interne Eigenentwicklungen. Spezialisierte Anbieter verfügen demnach über mehr Erfahrung bei der Umsetzung produktiver KI-Anwendungen.
red