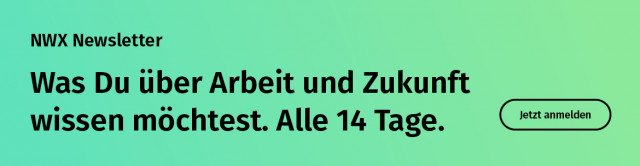Homeoffice forever oder Comeback fürs Büro?
Aktuelle Daten, Fakten, Statements zur Diskussion um den richtigen Arbeitsplatz
Vor Corona undenkbar, sind Homeoffice-Lösungen und andere hybride Arbeitsmodelle längst Teil des deutschen Arbeitsalltags geworden. Doch über die Frage, wie viel Präsenz und Flexibilität zwischen heimischen Schreibtisch und Büro nötig und richtig ist, wird nach wie vor diskutiert - und mitunter auch gestritten. Wir haben aktuelle Zahlen, wissenschaftliche Erkenntnisse und Statements gesammelt.
Gekommen, um zu bleiben: Hybride Modelle in Sachen Arbeitsorte und Arbeitszeiten haben sich in Deutschland etabliert und sind stabiler denn je. Die aktuelle Homeoffice-Studie der Universität Konstanz zeigt: Im Schnitt arbeiten Beschäftigte heute 2,2 Tage pro Woche von zu Hause aus. Besonders in der Informationswirtschaft bieten bereits 82 Prozent der Unternehmen mindestens einen Homeoffice-Tag pro Woche an.
Für die Mehrheit der Deutschen ist ein Mix aus zwei bis drei Tagen ortsunabhängiger Arbeit mittlerweile der perfekte Rhythmus. Komplett zurück ins Büro oder dauerhaft remote? Das wünschen sich nur wenige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dass Homeoffice kein vorübergehendes Phänomen ist, betont auch das ifo-Institut: „Unsere Daten zeigen keine Anzeichen für einen Rückgang“, erklärt ifo-Arbeitsmarktforscher Jean-Victor Alipour.
Hybridmodelle punkten nicht nur bei der Arbeitgeberattraktivität, sondern auch wirtschaftlich. Christiane Flüter-Hoffmann vom IW Köln nennt sie „einen echten Trumpf bei der Mitarbeitersuche“. Viele Beschäftigte berichten von gesteigerter Leistungsfähigkeit im Homeoffice. Der US-Ökonom Nick Bloom untermauert das im NWX-Podcast mit internationalen Zahlen: Zwei festgelegte Homeoffice-Tage pro Woche senken die Kündigungsrate um rund ein Drittel – und das ohne Einbußen bei der Produktivität. Entscheidend sind verlässliche Regeln und regelmäßige persönliche Treffen, die auf unterschiedliche Lebensphasen Rücksicht nehmen: Berufseinsteiger wünschen sich mehr Bürozeit, Eltern mit kleinen Kindern dagegen mehr Flexibilität.
Gleichzeitig bleibt das Büro als Ort der Begegnung und des spontanen Austauschs unverzichtbar. Volkswagen etwa reduzierte ab Frühjahr 2025 die mobilen Arbeitstage von vier auf zwei pro Woche, um die persönliche Anwesenheit zu stärken. Auch Unternehmen wie SAP, Otto oder die Deutsche Bank setzen wieder verstärkt auf Präsenz und begründen dies oft mit Innovationskraft, Informationssicherheit und den Erhalt der Unternehmenskultur. Mittlerweile schränken viele Firmen die Homeoffice-Möglichkeiten wieder ein: Laut Bitkom hat bereits jedes fünfte Unternehmen mobiles Arbeiten abgeschafft, weitere 15 Prozent planen das. Auch die Politik nimmt eine neue Haltung ein: Ab August 2025 dürfen Beschäftigte in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes nur noch mit Sondergenehmigung von zu Hause arbeiten, ab 2026 wird dies verbindlich.
Und: Kritiker warnen vor schlechterer Kommunikation und einem Auseinanderdriften der Unternehmenskultur. Auch Arbeitspsychologen wie Aldo Palkovich sehen die Gefahr einer „Entfremdung über die Distanz“. Ein - anonymer zitierter - Geschäftsführer bringt die Vorurteile, die es bei einigen Führungskräften immer noch gibt, in der Süddeutschen Zeitung auf den Punkt: „Homeoffice ist Arbeitsverweigerung in schöner Verpackung.“
Für Milena Bockstahler, Arbeitswissenschaftlerin am Fraunhofer IAO und Mitautorin der Studie Homeoffice Experience, liegt die eigentliche Debatte nicht beim Arbeitsort, sondern bei grundlegenden Fragen der Arbeitskultur: Vertrauen, Selbstorganisation, Zugehörigkeit. Ihre Forschung zeigt, dass sich ein Drittel der Beschäftigten im Homeoffice produktiver fühlt – gleichzeitig berichten rund 60 Prozent, dass der soziale und informelle Austausch zu kurz kommt und sie genau deshalb ins Büro gehen.
Das Büro, so Bockstahler im Interview mit dem NWX Magazin, entwickelt sich zunehmend vom täglichen Arbeitsplatz zum Ort für gezielten Austausch, kreative Prozesse und Teambuilding. Rund die Hälfte der Befragten ihrer Studien sehen es künftig vor allem als Begegnungsraum. Entscheidend sei, Räume so zu gestalten, dass sie einen klaren Mehrwert gegenüber dem Homeoffice bieten – durch modulare Konzepte, die sowohl Rückzug als auch Zusammenarbeit ermöglichen.
red / TH