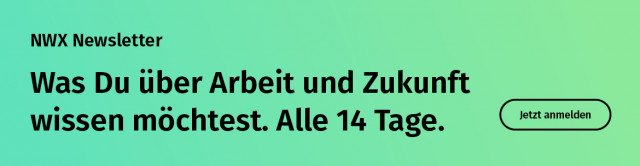„In Krisen wird emotionale Kompetenz der Führung zum Stabilitätsanker“
Interview mit Prof. Dr. Timo Lorenz
Wer (mit)fühlen kann, ist klar im Vorteil. Prof. Dr. Timo Lorenz* erklärt im Interview mit dem NWX Magazin, warum der positive Umgang mit eigenen und fremden Emotionen kein „Nice-to-have“, sondern ein entscheidender Erfolgsfaktor bei der Führung von Teams und Organisationen ist. Er zeigt, welche Vorteile (und Grenzen) emotionale Kompetenz von Führungskräften hat, wie man diese trainieren kann - und reines "Empathy Theater" kein Vertrauen schafft.
NWX Magazin: Herr Professor Lorenz, der Begriff "emotionale Intelligenz" wird schon seit einigen Jahren im Kontext moderner Führung benutzt, häufig allerdings mit unterschiedlichen Definitionen. Was verstehen Sie darunter in Bezug auf die Arbeitswelt?
Prof. Timo Lorenz: Ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu dem Begriff „emotionale Intelligenz“. Ich verstehe, warum er sich so gut durchgesetzt hat. Er klingt wissenschaftlich, signalisiert Bedeutung und verkauft sich schlicht besser. Trotzdem finde ich den Ausdruck „emotionale Kompetenz“ passender. Denn es geht weniger um ein angeborenes Talent als um erlernbare Fähigkeiten im Umgang mit Emotionen, also darum, eigene und fremde Gefühle wahrzunehmen, zu verstehen, zu regulieren und konstruktiv zu nutzen.
In der Arbeitswelt bedeutet das: Emotionen nicht als Störfaktor zu sehen, sondern als Informationsquelle. Führungskräfte mit emotionaler Kompetenz können dadurch klarer kommunizieren, besser auf ihr Team eingehen und gleichzeitig strategisch denken, eine Kombination, die gerade in komplexen, unsicheren Situationen entscheidend ist.
Okay, dann bleiben wir doch bei Ihrer Definition: Wie unterscheiden sich denn die Führungsstile von Managern mit hoher und niedriger emotionaler Kompetenz?
Lorenz: Führungskräfte mit hoher emotionaler Kompetenz zeichnen sich durch Ruhe, Selbstreflexion und echtes Zuhören aus. Sie können Feedback geben, ohne zu verletzen, und bleiben auch in schwierigen Gesprächen klar und respektvoll. Das schafft Vertrauen und psychologische Sicherheit im Team, eine zentrale Basis für Innovation, Engagement und konstruktive Zusammenarbeit.
Bei geringerer emotionaler Kompetenz zeigt sich oft das Gegenteil: unklare Kommunikation, impulsive Reaktionen oder die Tendenz, Konflikte zu vermeiden. Solche Führungskräfte wirken auf Mitarbeitende oft unberechenbar, etwa, wenn sie in Teamrunden plötzlich Kritik äußern, ohne Kontext zu geben, oder schwierige Themen vertagen, bis Spannungen eskalieren. Das führt schnell zu Verunsicherung, geringerer Motivation und letztlich zu höherer Fluktuation.
Gerade in Krisenzeiten wie diesen sollen Führungskräfte mit hoher emotionaler Intelligenz besonders profitieren. Welche Vorteile bringt das konkret für Teams und Organisationen?
Lorenz: In Krisen ist emotionale Kompetenz ein Stabilitätsanker. Wer seine eigenen Emotionen regulieren kann, bleibt ruhig und handlungsfähig, und genau das überträgt sich auf das Team. Führungskräfte, die klar kommunizieren und Emotionen ihrer Mitarbeitenden ernst nehmen, verhindern Eskalationen und fördern Zusammenhalt. Forschung zeigt, dass Teams unter emotional kompetenter Führung engagierter, belastbarer und innovativer sind. Das wirkt sich auch auf die Organisation aus, etwa durch geringere Fluktuation und höhere Leistungsbereitschaft.
"Der häufigste Fehler ist, Empathie zu spielen"
Welche typischen Fehler machen Führungskräfte, wenn sie versuchen, „empathisch“ zu wirken, es aber nicht authentisch tun?
Lorenz: Der häufigste Fehler ist, Empathie zu spielen. Man spricht dann von „Empathy Theater“, also netten Worten, die automatisch gesagt werden, jedoch ohne echtes Zuhören. Mitarbeitende merken das. Auch Überidentifikation ist problematisch: Wer Emotionen zu stark übernimmt, verliert Distanz und Entscheidungsfähigkeit.
Ebenso verbreitet ist falsche Nettigkeit, also der Versuch, Konflikte zu vermeiden, um harmonisch zu wirken. Das schafft kurzfristig Ruhe, langfristig aber Unsicherheit. Authentische Empathie bedeutet, ehrlich und respektvoll im Umgang zu sein, nicht, mit sich und anderen.
Wie können Führungskräfte in schwierigen Gesprächen – etwa bei Konflikten oder Kritik – emotional intelligent reagieren, ohne an Klarheit zu verlieren?
Lorenz: Das gelingt, wenn man emotional präsent, aber sachlich bleibt. Gute Vorbereitung hilft: Was will ich wirklich sagen? Welche Beobachtungen belegen mein Anliegen? Dann eine klare Struktur: das Ziel benennen, konkrete Beispiele nennen, die eigene Wahrnehmung schildern, die Perspektive des Gegenübers aktiv erfragen und gemeinsam nächste Schritte festlegen.
Wichtig ist, ruhig zu sprechen, Pausen zuzulassen und Emotionen zu benennen, ohne sie zu bewerten. Empathie darf dabei nie zu Nachgiebigkeit werden. Eine gute Balance klingt etwa so: „Ich verstehe Ihre Situation, gleichzeitig bleibt die Anforderung bestehen.“ Kurzum, seien Sie hart in der Sache, aber weich zum Menschen.
"Emotional kompetente Führung entsteht nicht im Workshop"
Gibt es Grenzen emotionaler Intelligenz im Führungsalltag?
Lorenz: Emotionale Kompetenz ist wichtig, aber kein Allheilmittel. Sie ersetzt keine Fachkenntnis, keine Strategie, kein analytisches Denken und keine fairen Strukturen. Sie kann auch überstrapaziert werden, etwa, wenn Führungskräfte emotionale Kompetenz manipulativ einsetzen oder sich zu sehr in die Emotionen anderer verstricken.
Zudem ist der Ausdruck von Empathie kulturell unterschiedlich. Was in einem Kontext warmherzig wirkt, kann in einem anderen als unangemessen gelten. Und schließlich: Wer ständig emotional verfügbar sein muss, läuft Gefahr, selbst auszubrennen. Auch das gehört zur Kompetenz, die eigenen Grenzen zu erkennen und zu respektieren.
Kann man denn emotionale Intelligenz oder Kompetenz überhaupt trainieren – und wenn ja, wie?
Lorenz: Ja, eindeutig. Studien zeigen, dass gezieltes Training wirken kann, vor allem wenn es praxisnah und über längere Zeit erfolgt. Es gibt hier jedoch keine Abkürzung, sondern es ist ein Prozess, der auch seine Zeit braucht, das sollte einem bewusst sein. Gute Programme kombinieren drei Ebenen: Emotionen wahrnehmen (zum Beispiel durch kurze Reflexionsübungen), Perspektiven übernehmen (etwa in Feedback- oder Rollentausch-Situationen) und Emotionen regulieren (zum Beispiel durch bewusste Neubewertung von Situationen, also die eigene Sichtweise hinterfragen und neu einordnen).
Entscheidend ist der Transfer in den Alltag. Trainings, die echte Gespräche und konkrete Arbeitssituationen einbeziehen, zeigen deutlich stärkere Effekte als reine Seminare. Emotional kompetente Führung entsteht nicht im Workshop, sondern im Alltag, mit den Menschen, mit denen wir arbeiten.
Welche Rolle spielt emotionale Intelligenz in der Auswahl und Entwicklung zukünftiger Führungskräfte?
Lorenz: Aus meiner Perspektive eine sehr große. Unternehmen suchen zunehmend Führungspersönlichkeiten, die reflektiert, empathisch und lernfähig sind, besonders in dynamischen, diversen Arbeitsumgebungen.
In der Auswahl sollte emotionale Kompetenz nicht isoliert bewertet werden, sondern stets im Zusammenspiel mit anderen relevanten Faktoren wie kognitiver Leistungsfähigkeit und beobachtbarem Verhalten. Besonders aussagekräftig sind praxisnahe Verfahren wie strukturierte Interviews oder Simulationen kritischer Führungssituationen, da sie authentisches Verhalten sichtbar machen, weit stärker als reine Selbstauskunftsfragebögen.
In der Entwicklung geht es darum, emotionale Kompetenz konkret zu verankern: Welche Verhaltensweisen zeigen empathische Führung? Wie sieht gelungene Selbstregulation in Stresssituationen aus? Solche klaren Anker helfen, das Thema greifbar zu machen und aus einem Schlagwort echte Führungsqualität werden zu lassen.
Interview: Ralf Klassen
*Zur Person: Prof. Dr. Timo Lorenz ist Juniorprofessor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der MSB Medical School Berlin. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Führung, psychologischem Kapital und der Gestaltung gesunder, inklusiver Arbeitskulturen. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit engagiert er sich für bessere Bedingungen für Nachwuchswissenschaftler*innen und den Transfer psychologischer Erkenntnisse in die Praxis.