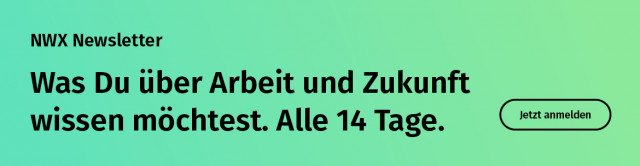„Zu viel Kontrolle führt in die Falle“: Wie Führung in der Krise gelingt
Leadership-Expertin Laura Bornmann im Interview
Krisen verändern nicht nur Märkte, sondern auch Menschen – und damit die Art, wie geführt werden muss. Alte Rezepte wie Kontrolle und Ansage funktionieren nicht mehr, wenn Orientierung fehlt und Unsicherheit dominiert. Leadership-Expertin Laura Bornmann erklärt im Interview mit dem NWX Magazin, warum moderne Führung Haltung, Mut und Menschlichkeit braucht – und weshalb Vertrauen gerade dann wächst, wenn Führungskräfte auch ihre Zweifel zeigen.
Laura Bornmann* ist Organisationsberaterin, Coach und eine der profiliertesten Stimmen, wenn es um moderne Führung in Zeiten radikaler Veränderung geht. Im Interview spricht sie über die neue Rolle von Führungskräften, die nicht länger durch Kontrolle, sondern durch Klarheit und Vertrauen Wirkung erzielen. Denn Führung in der Krise bedeute, Unsicherheit nicht zu bekämpfen, sondern sie zu gestalten – mit Selbstkenntnis, Empathie und der Fähigkeit, Widersprüche auszuhalten.
NWX Magazin: Frau Bornmann, was unterscheidet Führung in der Krise von „klassischer“ Führung in stabilen Zeiten?
Laura Bornmann: In stabilen Zeiten funktionierte die Formel: Ansage plus Kontrolle gleich Ergebnis. Man verließ sich auf bewährte Muster, Routinen und Planbarkeit. In der Krise brechen diese Sicherheiten weg. Menschen erleben Unsicherheit, Orientierungslosigkeit und teils auch Angst. Führungskräfte müssen heute mehr Orientierung geben – nicht durch starre Ansagen, sondern durch Klarheit im Denken, Transparenz im Handeln und eine klare Haltung. Führung bedeutet nicht mehr, Lösungen vorzugeben, sondern Räume zu schaffen, in denen Neues entstehen kann. Führungskräfte müssen außerdem lernen, Ambivalenzen auszuhalten und Widersprüche nicht als Fehler, sondern als Teil der Realität zu begreifen. Die Rolle verschiebt sich grundlegend: vom Steuernden zum Ermöglicher, vom Wissenden zum Fragenden, vom Kontrolleur zum Vertrauensgeber.
Welche typischen Reflexe oder Rückfälle in alte Muster erleben Sie in Krisenzeiten?
Bornmann: Typische Reflexe sind mehr Kontrolle, mehr Druck, mehr Distanz. Wenn Unsicherheit wächst, versuchen viele Führungskräfte wieder „festen Boden” unter die Füße zu bekommen. Sie führen enger, ziehen Entscheidungen an sich und überprüfen alles genauer. Das wirkt verständlich – doch genau darin liegt die Falle. Kontrolle wird zur vermeintlichen Sicherheit, erstickt aber die Kreativität und Eigenverantwortung, die Teams gerade jetzt brauchen. Viele versuchen zudem, neue Probleme mit alten Herangehensweisen zu lösen – sie greifen auf bekannte Werkzeuge und Muster zurück, die in stabilen Zeiten vielleicht funktioniert haben, in komplexen Situationen jedoch oft ins Leere laufen. Ein weiterer Rückfall ist die „Ansagekultur”: Führungskräfte glauben, sie müssten wieder alle Antworten selbst liefern. Dabei geht es in der Krise weniger um Wissen als um das Ermöglichen von Lernen und Entwicklung. Wer Komplexität mit Autorität beherrschen will, verliert die kollektive Intelligenz seines Teams.
Welche Kompetenzen halten Sie für unabdingbar, damit Führungskräfte Teams durch Unsicherheit und massive Transformation steuern können?
Bornmann: Führung in unsicheren Zeiten beginnt mit Selbstkenntnis. Wer die eigenen Ängste und blinden Flecken nicht kennt, läuft Gefahr, unbewusst in alte Muster zu verfallen. Selbstführung ist die Basis jeder guten Führung. Ebenso wichtig ist die Fähigkeit, Unsicherheit als Gestaltungsspielraum zu begreifen. Ich spreche von Veränderungsbegeisterung – der inneren Haltung dem Neuen mit Lust, Mut und offenem Blick für Chancen zu begegnen. Empathie spielt auch eine zentrale Rolle. In Momenten, in denen Orientierung fehlt, brauchen Menschen nicht nur Klarheit, sondern auch Verständnis. Führungskräfte müssen spüren, was ihr Team bewegt – Sorgen wahrnehmen, Emotionen ernst nehmen und Resonanz erzeugen. Dazu kommt Lernfähigkeit und die Bereitschaft, Überholtes loszulassen. „Verlernen” wird zur Schlüsselkompetenz: Nur wer alte Gewissheiten aufgibt, schafft Raum für neue Lösungen.
Untersuchungen zeigen, dass nur ein Bruchteil der Mitarbeitenden Führung tatsächlich vertraut. Welche konkreten Schritte können Führungskräfte unternehmen, um Vertrauen in Krisen schnell aufzubauen oder zurückzugewinnen?
Bornmann: Vertrauen entsteht in der Krise nicht durch perfekte Antworten, sondern durch Haltung. Führungskräfte gewinnen Glaubwürdigkeit, wenn sie Verletzlichkeit zeigen – Zweifel haben, Fehler eingestehen und trotzdem Verantwortung übernehmen. Wer offen sagt „Das weiß ich gerade nicht”, wirkt nicht schwach, sondern menschlich und vertrauenswürdig. Ebenso wichtig ist Kohärenz zwischen Worten und Taten. Mitarbeitende spüren sofort, ob jemand meint, was er sagt. Und Transparenz hilft: besser ehrlich über Unsicherheit sprechen, als falsche Gewissheiten vortäuschen. Vertrauen wächst durch Nähe – wenn Führung präsent bleibt, zuhört und zeigt: Ich stehe zu meinen Werten, auch wenn es schwierig wird.
"Menschlichkeit und Leistung bedingen einander"
Sie sprechen oft von „Menschlichkeit UND Leistung“ als Kern moderner Führung. Wie balanciert man in turbulenten Zeiten zwischen Verletzlichkeit zeigen und gleichzeitig Orientierung und Stabilität vermitteln?
Bornmann: Die Frage impliziert einen Widerspruch, der keiner ist. Menschlichkeit und Leistung bedingen einander. Meine Erfahrung ist: Menschen leisten mehr, wenn sie sich gesehen und sicher fühlen. Die Balance entsteht aus Klarheit in der Rolle: Verletzlichkeit schafft Verbindung, aber Führungskräfte müssen gleichzeitig Orientierung geben. Konkret: Wir können sagen „Ich weiß noch nicht, wie wir das lösen”, aber wir müssen im gleichen Atemzug sagen „aber ich weiß, dass wir es gemeinsam schaffen werden.” Das erste zeigt Ehrlichkeit, das zweite gibt Zuversicht. Authentizität bedeutet nicht, ungefiltert zu sein – es geht darum, in jeder Rolle echt zu sein, nicht grenzenlos offen.
Sollte eine Führungskraft denn auch ihre eigenen Unsicherheiten und Ängste offen kommunizieren, oder riskiert sie damit den Verlust von Vertrauen und Akzeptanz?
Bornmann: Ja, aber dosiert. Menschen vertrauen Führungskräften, die menschlich sind – nicht solchen, die unfehlbar wirken wollen. Sätze wie „Ich weiß es nicht” oder „Ich habe mich geirrt” sind kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Sie schaffen psychologische Sicherheit – die Voraussetzung dafür, dass auch andere offen über Zweifel sprechen können. Aber es gibt auch Grenzen: Wer Angst oder Ratlosigkeit unreflektiert ins Team trägt, überträgt sie weiter. Wer sie dagegen einordnet, benennt und mit einer klaren Haltung verbindet, schafft Vertrauen. Verletzlichkeit wirkt dann stärkend, wenn sie mit Klarheit, Haltung und Zuversicht einhergeht.
Krisen verschärfen häufig Ziel- und Erwartungsdruck von oben. Wie gelingt es Führungskräften, in diesem Spannungsfeld zugleich den Bedürfnissen der Mitarbeitenden gerecht zu werden, ohne zwischen beiden Polen „zerrieben“ zu werden?
Bornmann: Der Versuch, es allen recht zu machen, führt in die Überforderung. Statt sich zerreiben zu lassen, braucht es Klarheit über die eigene Rolle, Prioritäten und das Machbare. Ein zentrales Instrument ist Erwartungsmanagement: Wer offen über Ziele, Grenzen und Prioritäten spricht, schafft Orientierung auf beiden Seiten. Druck von oben lässt sich nicht vermeiden, aber man kann entscheiden, wie man ihn weitergibt. Wer Ziele nur „durchreicht”, vergrößert den Druck. Wer sie übersetzt, einordnet und Sinn stiftet, verwandelt ihn in Motivation. Gleichzeitig ist Selbstklärung zentral: Man kann die Bedürfnisse anderer nur wahrnehmen, wenn man die eigenen kennt. Und schließlich braucht es Resilienz – die Fähigkeit, auch unter Druck innerlich stabil zu bleiben, sich zu regulieren und die eigene Energie bewusst zu steuern. Nur wer gut für sich sorgt, kann auch für andere wirksam sein.
Sie betonen immer auch, dass KI und Automatisierung viele Aufgaben übernehmen können – Menschen aber Haltung und Herz einbringen müssen. Wie können Führungskräfte in Krisenzeiten diese Balance zwischen Effizienz durch Technologie und menschlicher Nähe wahren?
Bornmann: Je mächtiger KI wird, desto wertvoller wird Menschlichkeit. KI kann analysieren und optimieren – aber sie kann nicht inspirieren, vertrauen oder Sinn stiften. Genau darin liegt die Kernaufgabe von Führung. Die Balance besteht darin, KI als Werkzeug zu begreifen, nicht als Ersatz. Führung bedeutet, Technologie gezielt einzusetzen, um administrative Lasten zu reduzieren und so mehr Raum für echte Gespräche und Beziehungsgestaltung zu schaffen. KI kann ein wertvoller Sparringspartner für Entscheidungen sein – doch die Verantwortung für die finale Entscheidung bleibt beim Menschen.
"Selbstführung ist die Voraussetzung für Teamführung"
Ein weiteres zentrales Thema in Ihrer Arbeit ist die generationsübergreifende Zusammenarbeit. Wo entstehen in Transformationsprozessen die größten Reibungen zwischen den Generationen – und wie lassen sich diese produktiv nutzen?
Bornmann: Die größten Reibungen entstehen aus unterschiedlichen Grundannahmen über Arbeit. Für Babyboomer war Arbeit Pflicht und Stabilität, für die Gen Z steht Selbstverwirklichung im Vordergrund. Diese Haltungen treffen besonders in Krisenzeiten aufeinander. Doch genau darin liegt Potenzial. Die Älteren bringen Erfahrung und Durchhaltevermögen, die Jüngeren digitale Selbstverständlichkeit und frische Perspektiven. Der Schlüssel liegt darin, zu übersetzen statt zu bewerten. Formate wie Reverse Mentoring können Brücken schlagen. Und am Ende zeigt sich: Die Unterschiede sind oft gar nicht groß. Unter der Oberfläche ähneln sich die Bedürfnisse – alle wünschen sich Sinn, Entwicklung und Wertschätzung. Wenn Führung diese Gemeinsamkeiten sichtbar macht, verschwinden viele vermeintliche Gegensätze.
Wenn Sie Führungskräften nur eine einzige Botschaft mit auf den Weg geben könnten, um ihre Teams und sich selbst kraftvoll durch Transformationen zu führen – welche wäre das?
Bornmann: Fangen Sie bei sich selbst an. Die meisten Führungskräfte optimieren Prozesse, Strukturen, Strategien – nur nicht sich selbst. Dabei liegt darin der größte Hebel. Ihre ungeklärten Ängste und unreflektierten Muster übertragen sich täglich auf das Team. Selbstführung ist die Voraussetzung für Teamführung. Das bedeutet konkret: Kennen Sie Ihre Werte, Stärken und Schwächen. Seien Sie sich darüber bewusst, was Sie triggert und warum. Und haben Sie den Mut, echt zu sein – nicht perfekt, sondern authentisch. Menschen vertrauen Menschen. Die gute Nachricht: Das ist trainierbar. Nehmen Sie sich Zeit für Reflexion, holen Sie sich ehrliches Feedback, investieren Sie in Coaching. In einer technologischen Welt ist Menschlichkeit Ihr größter Wettbewerbsvorteil.
Interview: Ralf Klassen
*Zur Person: Laura Bornmann ist eine der führenden Stimmen für New Leadership in Deutschland. Ihre Erfahrung ist praxisnah und fundiert: Bereits mit 28 Jahren übernahm sie die Leitung der Personalentwicklung bei REWE für rund 18.000 Mitarbeitende. Später baute sie als Managing Director von Startup Teens und Gen Talents ein erfolgreiches HR-Beratungsgeschäft auf. Sie plädiert für eine Führungskultur, die Menschlichkeit mit Leistungsorientierung verbindet. Mehr unter: https://laura-bornmann.de/