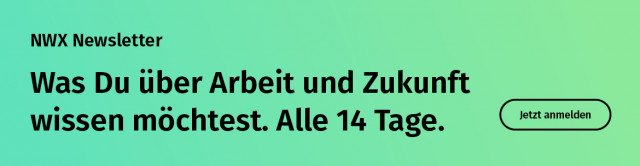Trendthema Upskilling: Vom "Nice to have" zum "Do or Die"
Weiterbildung für die Jobs der Zukunft
Noch nie war Lernen so eng mit beruflichem Erfolg verknüpft wie heute. Ob künstliche Intelligenz, ökologische Transformation oder demografischer Wandel – die Kräfte, die unsere Arbeitswelt gerade umgestalten, wirken gleichzeitig und in ungekanntem Tempo. Neue Berufsbilder entstehen, bestehende Tätigkeiten verschwinden, ganze Branchen stellen ihre Kompetenzprofile um. Berufliche Weiterbildung ist so nicht länger eine Frage von Zusatzqualifikationen, sondern eine strategische Notwendigkeit - auch für Führungskräfte.
Der Future of Jobs Report 2025 des World Economic Forum zeigt das Ausmaß dieser Entwicklung: Bis 2030 werden voraussichtlich 22 Prozent aller heutigen Arbeitsplätze von strukturellen Veränderungen betroffen sein. Zwar entstehen gleichzeitig zahlreiche neue Stellen, doch entfallen ebenso viele bestehende – unterm Strich ergibt sich ein weltweiter Nettozuwachs von rund 78 Millionen Jobs. Auch die Kompetenzanforderungen verschieben sich tiefgreifend. Etwa 39 Prozent der heute zentralen Fähigkeiten werden sich bis 2030 verändern. Dieser Wert liegt leicht unter dem von 2023 (44 Prozent), verweist aber weiterhin auf eine hohe Dynamik.
Trendthema Upskilling und der Wandel der Arbeitsplätze
Entscheidend für Beschäftigte und Unternehmen ist die Fähigkeit, sich in dieser Situation ausreichend schnell neu aufzustellen. Nach den Analysen des Reports benötigen bis 2030 rund 59 Prozent der Arbeitskräfte eine Neuausrichtung ihrer Fähigkeiten. Davon können 29 Prozent in ihrer bisherigen Funktion bleiben, wenn sie die erforderlichen Zusatzqualifikationen erwerben, 19 Prozent werden in neue Tätigkeiten umgeschult, während elf Prozent voraussichtlich nicht in ausreichendem Maß weiterentwickelt werden können. Dass Unternehmen verstärkt handeln, zeigt sich bereits: Der Anteil der Beschäftigten, die an Weiterbildungsprogrammen teilnehmen, ist seit 2023 von 41 auf 50 Prozent gestiegen.
Besonders gefragt sind dabei Kompetenzen in vier großen Feldern:
- Technologische Fähigkeiten wie Artificial Intelligence & Big Data, Netzwerke & Cybersecurity sowie grundlegende digitale Kenntnisse
- Kognitive und soziale Skills wie analytisches Denken, Resilienz, Flexibilität und Agilität
- Führungs- und Einflusskompetenzen
- Neugier, Lernbereitschaft und Umweltbewusstsein
Getrieben wird dieser steigende Qualifizierungsbedarf vor allem von technologischen Veränderungen. KI, Automatisierung und Digitalisierung verändern nicht nur Tätigkeitsprofile, sondern auch die Erwartungen an Beschäftigte. Hinzu kommen demografische Verschiebungen: Die Alterung der Bevölkerung und neue gesellschaftliche Prioritäten lassen den Bedarf an Fachkräften in Bereichen wie Pflege, Bildung und Talentmanagement wachsen.
Wachstum gefragter Kompetenzen und Qualifizierungsstrategien
Auch die ökologische Transformation hat unmittelbaren Einfluss. Der Bedarf an umweltbezogenen Kompetenzen nimmt deutlich zu; rund um erneuerbare Energien und Umwelttechnologien entstehen neue Berufsbilder. Ergänzend wirken geopolitische Spannungen und gestörte Lieferketten als zusätzliche Treiber, die insbesondere Kompetenzen im Bereich Cybersicherheit und internationale Anpassungsfähigkeit verstärkt in den Vordergrund rücken.
Für Deutschland wurden die Erkenntnisse durch eine Partnerschaft zwischen dem WEF und der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP) gewonnen, die die deutschlandspezifischen Daten und Analysen beisteuerte. Diese Ergebnisse zeigen einen im internationalen Vergleich nochmals erhöhten Handlungsdruck: Rund 60 Prozent der Beschäftigten hierzulande müssen bis 2030 um- oder weiterqualifiziert werden – ein Anteil, der leicht über dem globalen Durchschnitt liegt. Zudem planen 85 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland, Weiterbildung gezielt zu priorisieren. Besonders technologische Kompetenzen wie KI und Big Data gelten als Wachstumstreiber: Rund 90 Prozent der deutschen Unternehmen stufen diese als zunehmend wichtig ein. Parallel dazu wird der Einfluss der ökologischen Transformation stark betont: 60 Prozent der Firmen messen Klimaschutzmaßnahmen bereits heute einen prägenden Stellenwert bei. Besonders gefragt sind Fachkräfte in Bereichen wie erneuerbare Energien, Umwelttechnik und Nachhaltigkeit.
Upskilling für Führungskräfte: Neue Anforderungen an Leadership
Ein spezielles Augenmerk liegt zunehmend auf Upskilling-Maßnahmen für Führungskräfte. Studien zeigen, dass gerade in Zeiten schneller technologischer und gesellschaftlicher Veränderungen die Kompetenzentwicklung bei Führungspersonen zentral ist, um Organisationen erfolgreich durch Unsicherheiten zu steuern. Der HR-Report 2025, eine Befragung von 975 Fach- und Führungskräften im deutschsprachigen Raum, macht deutlich: Rund 48 Prozent der Unternehmen setzen auf Upskilling als Strategie, insbesondere um Fähigkeiten in bestehenden Aufgabenfeldern zu erweitern. Für Führungskräfte bedeutet das, ihre Fähigkeiten in Bereichen wie digitaler Transformation, Change Management und sozialer Einflussnahme konsequent auszubauen.
Darüber hinaus gewinnen Programme zur sogenannten „empowernden Führung“ an Bedeutung, die darauf abzielen, Führungskräfte in ihrer Rolle als Ermöglicher von Teamautonomie, psychologischer Sicherheit und geteilter Verantwortung zu stärken. Laut aktuellen Branchenanalysen ist die Nachfrage nach solchen Leadership-Trainings in den letzten Jahren stark gestiegen.
Thorben Hansen / red